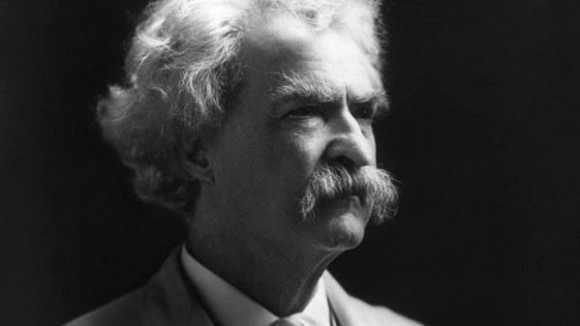Henryk M .Broder / Wikipedia / Creative Commons
Wenn Henryk M. Broder von jemanden behauptet, er verstünde etwas nicht richtig, dann meint er damit gewöhnlich: „Jemand hat eine andere Meinung als ich“. Diesmal geht es dem „Welt“-Kolumnisten um Sascha Lobo, der in in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ ausführlich, sehr persönlich und ziemlich gut über die Deformation des Internets durch die NSA-Affäre geschrieben hat („Das Internet ist kaputt“). Alles nicht so schlimm, meint Broder, denn Lobo „versteht nur das Wesen der Dinge nicht richtig“.
Das Internet sei weder kaputt noch gut oder böse. Es handle sich ja nur um eine Technologie. Und Technologien würden manchmal eben missbraucht. So wie ein Lastwagen, der Soldaten an die Front transportiere statt Tomaten auf den Markt. Oder ein Messer, mit dem man nicht immer Brot schneide, sondern manchmal auch die Schwiegermutter. Oder ein Kondom, das prinzipiell ja auch für eine Vergewaltigung…..Und so weiter und so weiter.
Man kennt diese Argumentation von amerikanischen Waffenlobbyisten: Das Gewehr ist nie das Problem, höchstens der Schütze. Also her mit der Knarre.
Wie in jeder Digital-Debatte darf natürlich auch die beliebte Buchdruck-Analogie nicht fehlen. Der Blogger Don Dahlmann kann zwar den „Frust von Sascha Lobo verstehen“, tröstet aber mit dem Hinweis auf die Luther-Bibel:
„Weder konnte die Überwachung der Druckereien, noch konnten Strafen die Verbreitung verhindern. Mitte des 17. Jahrhunderts stand die Luther-Bibel in 40 % aller deutschsprachigen Haushalte“.
(Die Zahl bezweifle ich übrigens, denn unmittelbar nach dem 30-jährigen Krieg könnte das Luther-Bibel-Geschäft an deutlich mehr als an 60 Prozent der deutschsprachigen Haushalte vorbei gegangen sein. Wegen folgender Ausschlusskriterien: 1. Armut 2. Analphabetismus 3. Katholizismus).
Es hat etwas Ironisches, wenn ausgerechnet die Gesundbeter der Internets mit analogen Gegenständen wie Messern, Kondomen und Luther-Bibeln argumentieren. Was sie dabei übersehen: Es geht nicht um die Verbreitung einer Technologie, nicht um ihren gelegentlichen Missbrauch und auch nicht um die von Karsten Lohmeyer behandelte Frage, wie wir das jetzt Internet besser oder produktiver nutzen können.
Es geht darum, dass Kommunikation und Überwachung im Internet siamesische Zwillinge sind, die niemand voneinander trennen kann – jedenfalls nicht nach heutigem Stand der Dinge. Die Spitzel-Affäre mit ihren Verästelungen bis in die Werbeindustrie hinein ist kein Betriebsunfall im Internet, sie ist Teil des Internets. Und anders als friedliche Nutzer von Messern, Lastwagen und Kondomen sind harmlose Onliner nicht die Guten. Sondern die Dummen.
Wir liefern Futter für die Kraken. Mit unseren Daten und Cookies mästen wir das Monster. Wir verdammen den Missbrauch des Internets und machen ihn zugleich möglich, jeden Tag, mit jedem Klick. Egal ob auf Facebook, in einer Mail oder über einer Suchanfrage. Eine Wahl haben wir nicht, denn es gibt kein anderes Internet. Das ist das Dilemma. Reden wir also nicht von Kondomen.